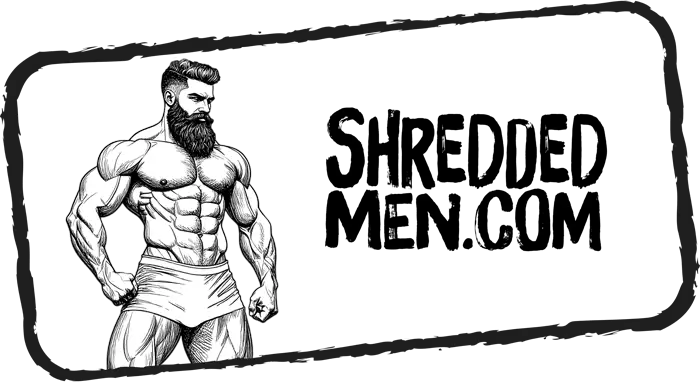血の中の炎:トルコ人、クルド人、レバノン人の気質
Im Spiegel von Testosteron, Kultur und gelebter Maskulinität: „Ich nehme Raum ein, ich weiss, wer ich bin.“ Doch was steckt wirklich hinter dem sogenannten „Temperament“ dieser Männer? Ist es ein Mythos? Ein kulturelles Konstrukt? Ein Ergebnis von Testosteronwerten, Ernährung, Klima, Geschichte und sozialen Normen? Und welche Rolle spielt dieses Temperament in einer Welt, in der Männlichkeit auf der einen Seite kritisiert, auf der anderen Seite jedoch gerade in subtiler Form mehr denn je von Frauen gesucht wird?
Was bedeutet Temperament überhaupt? Temperament ist in der Psychologie die Summe angeborener, biologisch bedingter Persönlichkeitsmerkmale, die das Verhalten, die Emotionalität und die Reaktionsmuster eines Menschen prägen. Schon Hippokrates unterschied vier Temperamenttypen (sanguinisch, cholerisch, melancholisch, phlegmatisch) und noch heute wird in der Persönlichkeitsforschung untersucht, wie biologische Faktoren (Hormone, Neurotransmitter) mit erlernten kulturellen Mustern verschmelzen.
Wenn wir über „das südländische Temperament“ sprechen, meinen wir meist:
Doch woher kommt das?
Testosteron: Mythos und Realität
Testosteron ist ein Hormon, das sowohl körperlich als auch psychisch Einfluss nimmt. Es wird oft mit Aggression, Sexualtrieb, Dominanzstreben und körperlicher Kraft in Verbindung gebracht, doch Studien zeigen, dass es komplexer wirkt. So zeigt eine Metaanalyse von Archer (2006), dass Testosteron in sozialen Kontexten vorrangig das Status- und Dominanzstreben fördert, nicht pauschal Aggression.
Regionale Unterschiede im Testosteronspiegel sind schwer eindeutig zu quantifizieren, da Kultur, Ernährung und Lebensstil eine grosse Rolle spielen. Eine Studie von Mazur & Booth (1998) zeigte, dass soziale Dominanz und sexuelle Aktivität den Testosteronspiegel steigern können, nicht nur umgekehrt. Das bedeutet: Wer in einer Kultur lebt, in der Männlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit und sexuelle Aktivität hoch bewertet werden, hat oft einen Lebensstil, der den Testosteronspiegel tendenziell höher hält.
Ernährung, Klima und Sonne
Südländer konsumieren traditionell mehr Fleisch, Innereien, Nüsse, Hülsenfrüchte, Olivenöl und Gewürze. Diese Ernährungsweise ist reich an Zink, gesunden Fetten und Vitamin D; alles Faktoren, die den Testosteronspiegel unterstützen können. Das sonnenreiche Klima fördert eine höhere Vitamin-D-Produktion, die in direktem Zusammenhang mit dem Testosteronspiegel steht (Pilz et al., 2011, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism).
Kulturelle Verstärker: Libanesen, Türken und Kurden stammen aus Kulturen, in denen Männlichkeit hoch bewertet wird. Stärke, Verantwortung für Familie, die Bereitschaft, diese Familie zu verteidigen, sowie Respekt und Status sind Teil des sozialen Kodexes. Junge Männer lernen früh, mit direkter Kommunikation, körperlicher Präsenz und Loyalität ihren Platz zu finden. Wer sich nicht behauptet, wird überrannt.
Beobachtungen in migrantischen Communities in Europa zeigen, dass junge Libanesen oder Türken oft eine doppelte Identität entwickeln: Sie tragen die Maskulinitätscodes ihrer Heimat in sich, während sie gleichzeitig in einer westlichen Gesellschaft sozialisiert sind, die diese Codes kritisch betrachtet. Dies führt oft dazu, dass diese Männer ihre Maskulinität selbstbewusst leben und gleichzeitig mit den Regeln des Gastlandes balancieren.
Warum „Temperament“ attraktiv ist
In zahlreichen Studien wird bestätigt, dass Frauen weltweit in unterschiedlichen Kulturen bestimmte Aspekte männlicher Dominanz als attraktiv empfinden, solange sie mit Fürsorge und sozialer Kompetenz kombiniert sind (Gangestad & Simpson, 2000). Das bedeutet nicht „toxische Maskulinität“, sondern die Fähigkeit eines Mannes, sich durchzusetzen, zu beschützen und Verantwortung zu übernehmen.
Südländisches Temperament signalisiert oft:
Testosteron und die nationale, kulturelle Identität
Testesteron hat Einfluss auf die Psyche und das Verhalten von Männern. Männlichkeit wird durch gesellschaftliche Konventionen und Traditionen besonders verstärkt und äussert sich besonders in folgenden Kulturkreisen:
In der türkischen Gesellschaft ist der „Adam gibi adam“ (der „richtige Mann“), ein Ideal, das tief verankert ist. Gemeint ist ein Mann mit Rückgrat, der weiss, wann er reden und wann er schweigen muss, der seine Familie beschützt, Respekt gegenüber Älteren zeigt und gleichzeitig weiss, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Dieses Ideal ist nicht zwingend laut oder aggressiv, sondern souverän, selbstsicher und oft charismatisch.
Ein zentraler Bestandteil türkischer Männlichkeit ist äussere Pflege, die jedoch nicht mit Eitelkeit verwechselt werden sollte. Vielmehr ist sie Teil des Selbstverständnisses: Ein echter Mann geht ins Gym, rasiert oder trimmt seinen Bart regelmässig, trägt gepflegte Kleidung und achtet auf Körperhaltung. Besonders bei jungen Männern der urbanen Mittelschicht in Städten wie Istanbul, Izmir oder Ankara zeigt sich eine starke Tendenz zu ästhetischer Selbstinszenierung, die aber nicht als „weich“ gelten darf. Sie ist Ausdruck von Kontrolle, Stolz und Status.
Doch in konservativeren Regionen, etwa in Zentralanatolien, dominiert noch stärker das Bild des Versorgers, der nicht viel redet, aber für die Familie da ist, oft mit klaren Hierarchien. Emotionale Nähe wird innerhalb der Familie gezeigt, gegenüber Fremden hingegen bewahrt man Haltung.
In der türkischen Diaspora, etwa in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden, vermischen sich diese Muster mit westlichen Einflüssen. Junge türkischstämmige Männer wachsen in einem Spannungsfeld auf: Zuhause gelten patriarchale Familienstrukturen, in der Schule oder am Arbeitsplatz westliche Gleichstellungsideale. Diese Reibung führt häufig zu einer bewussten Re-Inszenierung traditioneller Männlichkeit: „Ich bin Mann, nicht trotz des Systems, sondern als bewusste Entscheidung.“
Kurdische Männlichkeitsbilder sind stark durch politische, soziale und familiäre Strukturen geprägt. In vielen kurdischen Regionen, sei es im Südosten der Türkei, im Nordirak, in Nordsyrien oder im Iran, sind Clanstrukturen und eine stark kollektive Lebensweise prägend. Ein Mann ist nicht nur Individuum, sondern immer Teil eines grösseren Systems: Familie, Dorf, Stamm, Region.
Die Figur des kurdischen Mannes ist tief mit Konzepten wie Widerstand, Ehre und Gemeinschaft verbunden. Viele kurdische Männer wachsen mit Geschichten über Kampf, Unterdrückung und Stolz auf. Die Idee, ein „Mann“ zu sein, bedeutet in diesem Kontext oft, für Werte einzustehen, sei es für die Familie, für das eigene Volk oder für eine gerechte Sache. Emotionale Härte gegenüber der Aussenwelt wird mit einer grossen emotionalen Tiefe innerhalb der Familie kombiniert: Es ist nicht ungewöhnlich, dass kurdische Männer intensiv lachen, weinen, singen oder tanzen, aber nur in einem geschützten Raum.
Im Gegensatz zum eher kontrollierten, stilisierten türkischen Männerbild ist die körperliche und emotionale Ausdrucksstärke bei vielen Kurden offener. Kurdische Männer umarmen sich, tanzen eng, drücken Gefühle deutlich aus, aber verlieren nie den Anspruch, als „starke Männer“ gesehen zu werden.
Ein weiterer Aspekt: Gastfreundschaft. In vielen kurdischen Haushalten ist es Ehrensache, Gäste zu bewirten, ihnen das beste Stück Fleisch anzubieten und Respekt zu zeigen, ganz unabhängig vom sozialen Status. Dies ist Teil eines maskulinen Ehrenkodexes, der viel mit Grosszügigkeit und Würde zu tun hat.
Im Libanon ist Männlichkeit weit mehr als eine biologische oder gesellschaftliche Rolle, sie ist ein zentraler Bestandteil der persönlichen Identität, tief verwoben mit Familie, Religion, Stolz und sozialem Status. Der libanesische Mann wird oft als leidenschaftlich, temperamentvoll und beschützend beschrieben. In seinem Selbstverständnis verbindet er traditionelle Werte mit emotionaler Präsenz und sozialer Dominanz. Dieses Bild kann in westlichen Augen schnell als „machohaft“ erscheinen, doch im libanesischen Kontext ist es Ausdruck von Stärke, Verantwortungsbewusstsein und kulturellem Stolz.
Männlichkeit beginnt im Libanon nicht mit dem Erreichen des Erwachsenenalters, sondern wird früh geprägt: Ein Junge lernt schon als Kind, dass er seine Familie verteidigen, seine Mutter respektieren und seine Schwestern beschützen muss. Das Konzept von Ehre (Sharaf) steht im Zentrum, nicht nur im Sinne von persönlicher Würde, sondern als kollektives Gut, das durch das Verhalten der männlichen Familienmitglieder aufrechterhalten wird. Wer Ehre verliert, verliert gesellschaftliche Stellung und damit auch seine männliche Anerkennung.
Diese Verantwortung erzeugt Druck, aber auch Stolz. Der libanesische Mann zeigt sich gerne dominant, laut, präsent. Er will gesehen werden, sei es durch Kleidung, Körpersprache oder sein Auftreten im öffentlichen Raum. In vielen Familien ist es selbstverständlich, dass der Vater das letzte Wort hat, Entscheidungen trifft und die Familie finanziell wie moralisch „führt“. Dieses Rollenverständnis basiert auf einem traditionellen, aber funktionierenden System aus gegenseitigem Respekt und klaren Hierarchien.
Das Macho-Sein hat im Libanon zwei Gesichter. Einerseits bedeutet es Kontrolle, Führungsanspruch und eine gewisse Härte im sozialen Auftritt. Andererseits beinhaltet es emotionale Wärme, Fürsorge und Nähe, vor allem innerhalb der Familie. Libanesische Männer sind bekannt für ihre starke Bindung an die Mutter, für ihre Treue gegenüber der Familie und ihre emotionale Ausdruckskraft. Sie umarmen ihre Freunde, zeigen offen Trauer, lachen laut und diskutieren mit Leidenschaft. In privaten Räumen sind sie oft zugänglicher, weicher und nahbarer als das öffentliche Bild vermuten lässt.
In der Diaspora, etwa in Kanada, Frankreich oder Deutschland, zeigt sich eine interessante Dynamik: Viele junge libanesischstämmige Männer versuchen, ihre maskulinen Ideale zu bewahren, gleichzeitig aber in westlichen Gesellschaften zu navigieren, die männliche Dominanz kritisch hinterfragen. Das Resultat ist eine neue Form von Männlichkeit: gepflegt, körperlich präsent, stolz, aber auch anpassungsfähig, reflektiert und emotional kompetent.
Das libanesische Macho-Bild ist also nicht eindimensional. Es ist ein kulturelles Erbe, das in Zeiten globaler Unsicherheit Halt gibt, aber sich gleichzeitig verändert. Der moderne libanesische Mann ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein Produkt von Geschichte, Familie und Anpassung. Sein Macho-Sein ist nicht Aggression, sondern ein Ausdruck von Verantwortung, Bindung und Identität.
Was sagen Frauen dazu?
Aus Interviews und qualitativen Studien (u.a. Buss, 1989) wissen wir: Frauen fühlen sich oft zu Männern hingezogen, die eine Kombination aus Dominanz und Fürsorglichkeit zeigen. Das südländische Temperament signalisiert genau das: Ich kann dich beschützen, ich kann führen, aber ich kann auch lachen, weinen und Nähe zulassen. Frauen berichten, dass sie die Energie, die von solchen Männern ausgeht, spüren: Der feste Blick, der körperliche Ausdruck, die Unerschrockenheit im sozialen Raum. Gleichzeitig betonen viele, dass diese Männer oft warmherzig und respektvoll im persönlichen Umgang sind.
Testosteron und Training
Viele Türken, Kurden und Libanesen legen grossen Wert auf ihr körperliches Erscheinungsbild. Krafttraining, Kampfsport, Fussball oder körperlich fordernde Arbeit gehören zum Alltag. Bewegung und Muskelaufbau sind bekannte Stimulatoren für Testosteron (Kraemer & Ratamess, 2005). Wer regelmässig trainiert, hat oft nicht nur mehr Muskelmasse, sondern auch eine verbesserte Körperhaltung und Ausstrahlung.
Traditionelle Fleischgerichte, Nüsse, Olivenöl, Gewürze wie Kreuzkümmel und Chili, viel Sonne; all dies sind Faktoren, die helfen können, Testosteron auf einem gesunden Level zu halten. Hinzu kommt ein oft geringerer Alkoholkonsum im Vergleich zu westlichen Ländern, was sich positiv auf den Hormonhaushalt auswirkt.
Das Klischee, südländisches Temperament sei gleichzusetzen mit Aggression, greift zu kurz. In vielen dieser Kulturen wird Aggression nur dann gezeigt, wenn es um den Schutz von Familie oder Ehre geht. Im Alltag sind viele Männer freundlich, warm und humorvoll, zeigen aber gleichzeitig klare Grenzen, wenn sie provoziert werden.
Testosteron ist ein Faktor im Spiel, aber nicht der einzige. Kultur, soziale Normen, Ernährung, Bewegung und Klima spielen eine zentrale Rolle darin, warum Türken, Kurden und Libanesen ein lebendiges Temperament zeigen. Dieses Temperament ist kein Mangel an Kontrolle, sondern oft eine Form von gelebter Lebendigkeit.
Es bedeutet:
Externe Links zu diesem Thema
Hormonspezialisten: Testosteron
Bundeszentrale für politische Bildung | Vom Singular zum Plural: Männlichkeit im Wandel • Essay
Wikipedia.de | Temperamentenlehre
Beim Klicken auf einen dieser Links, die auf eine externe Website führen,
sind ausschliesslich deren Betreiber für deren Inhalte verantwortlich und somit verlässt du «Shredded Men».
«Shredded Men» hat keinen Einfluss auf Gestaltung, Sicherheit oder Aktualität der dort angebotenen Inhalte.
Bitte lese dazu auch die Datenschutzbestimmungen und den Haftungsausschluss von «Shredded Men».
Fazit
Für Männer kann es inspirierend sein, sich Teile dieses Temperaments bewusst zurückzuerobern: Durch Training, Sonnenlicht, gesunde Ernährung, klare soziale Grenzen und eine emotionale Lebendigkeit, die erlaubt, Freude, Trauer, Wut und Liebe auszudrücken.
Für Frauen bleibt diese Form gelebter Männlichkeit attraktiv, nicht, weil sie aggressiv ist, sondern weil sie Sicherheit, Präsenz und Abenteuer ausstrahlt. In einer Welt, die oft von neutralisierten Geschlechterrollen spricht, wird diese Form von Männlichkeit nicht verschwinden, sondern weiterhin in Clubs, Cafés, Gyms und Strassen sichtbar sein, weil sie zutiefst menschlich ist.
Artikel liken
Gib diesem Artikel ein «Like», wenn er dir gefallen hat und
du zukünftig mehr Themen dieser Art lesen möchtest.